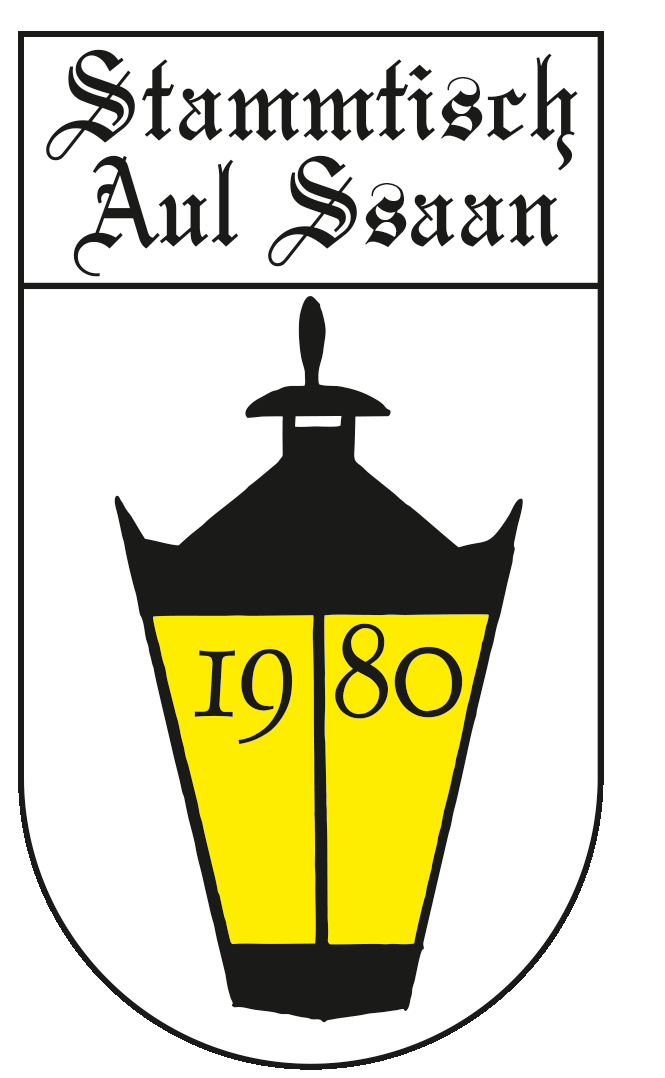Klosterstraße 53-55
Denkmal
Denkmal - Klosterstraße 53-55
Als Gründungsdatum des Klosters „Aula Beatae Mariae" (Saal der seligen Maria, kurz:
Mariensaal) ist das Jahr 1214 überliefert. Der Kölner Erzbischof Engelbert I.
verhalf dem Kloster in der Gründungszeit aus einer wirtschaftlichen Notlage.
Unter der Äbtissin Wolberna wurde das Kloster in den Zisterzienserorden
aufgenommen und der Abtei Camp als Tochterkloster unterstellt.
Der Vorgänger der heutigen Kirche entstand in der Mitte des 13. Jahrhunderts.
Über die Jahrhunderte wechselten Perioden klösterlicher Prosperität mit Zeiten
des Verfalls; auch der Kirchenbau zeigt Spuren der wechselnden Geschichte.
Erhalten sind zwei Joche des 13. Jahrhunderts, die einen einschiffigen Raum
bilden; gedeckt durch ein verschiefertes Dach mit Dachreiter (im Kern aus
dem 14./15. Jahrhundert).
1808 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisierung aufgelöst; die Kirche
behielt jedoch ihre Funktion als Pfarrkirche.
1813 kam der Besitz des Klosters an die preußische Domänenverwaltung;
die Klostergebäude wurden anschließend unterschiedlich genutzt; so befanden
sich u.a. von 1815 – 1862 eine Gewehrfabrik und von 1878 – 1933 eine
Tapetenfabrik in den Gebäuden des Klosters, einige Teile dienten einer
landwirtschaftlichen Nutzung.
Einige Gebäudeteile wurden Anfang der 1930er Jahre für den Bau der heutigen
Bundesstraße 1 niedergelegt.
Ein monumentales Grabdenkmal neben der Kirche kündet von dem Tod der
letzten Äbtissin Friderica Agatha von Heinsberg im Jahre 1822.
Von Sylvestre Trenelle, dem Eigentümer der Gewehrfabrik, der sie von 1815
bis 1840/42 leitete und in dieser Zeit im Äbtissinenhaus auf dem Kloster-
gelände wohnte, wird berichtet, dass er 1834 den jungen Felix Mendelssohn-
Bartholdy bei sich zu Gast hatte.
Der 1895/97 durchgeführte Umbau der Kirche zeugt vom zahlenmäßigen
Wachstum der Saarner Gemeinde zu jener Zeit.
Der romanische Chor fiel dieser Erweiterung der Kirche zum Opfer. Es wurden
jedoch ein weiteres Joch mit Seitenschiff, ein Querhaus sowie Chor und Apsis
neu angefügt.
Weitere Umbaumaßnahmen wurden 1926 (Ausmalung, Abbruch des barocken
Eingangs an der Südseite, neuer Vorraum mit Eingang an der Westseite),
1946 (Neugestaltung des Kirchenraumes und Chorfenster von Ludwig Baur,
Telgte) und 1963 (Renovierung der Kirche - Architekt Heinz Thoma, Düsseldorf,
neue Fenster im Chorraum, im Langhaus und Rosetten im südlichen Querschiff
von Paul Weigmann, Opladen) durchgeführt.
Ab 1979 erfolgte, nach durchgeführter umfangreicher Bauforschung, die
Restaurierung und die Neugestaltung des Kirchenraumes durch die
Architekten Karl-Otto Lüfkens, Krefeld, und Manfred Fürle, Mülheim an der
Ruhr. Eine wesentliche Maßnahme war dabei die Wiederherstellung der
Nonnenempore in der ursprünglichen Anordnung.
Neben der Restaurierung der historischen Ausstattungsstücke kamen
bemerkenswerte moderne Kunstschmiedearbeiten neu in die Kirche
(Fassung der Madonna im Chorraum, Osterleuchter, Emporengitter erstellt
durch Paul Nagel, Wesseling).
1990 erfolgte der Einbau der Schwalbennestorgel und 1993 wurde die
Emporenorgel (Orgelbau Friedhelm Fleiter, Münster-Nienberge) eingebaut.
Ab 1933 wurden Teile der Wirtschaftsgebäude zu Wohnzwecken genutzt. Sie
wurden 1979 von der SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und Bau-
gesellschaft GmbH, Mülheim an der Ruhr, übernommen und neu hergerichtet.
Sehenswert ist neben der Kirchenausstattung das im Jahr 2008 eingeweihte
Kloster-Museum, in dem die archäologischen Untersuchungsergebnisse von
Kirche und Kloster dokumentiert sind. Auch wird in ihm das frühere Leben im
Kloster erlebbar gemacht.
Auch der Klostergarten wurde neu angelegt und wird mittlerweile pädagogisch
genutzt.
Für die Richtigkeit: „Ein Projekt des Stammtisches „Aul Ssaan“
F. Wilhelm von Gehlen